Für viele von uns ist nach dem Schulabschluss mit dem Sprachenlernen Schluss. Dabei profitieren vom Sprachtraining sowohl unsere kognitiven Fähigkeiten als auch unsere Karriere. Sollten wir also mehr Zeit und Aufwand in das Lernen einer Zweit- oder Drittsprache stecken? Wie bringt uns Sprachtraining persönlich weiter und wie wichtig sind Fremdsprachen im Beruf? Diesen Fragen gehen wir in diesem Artikel auf den Grund.

Welche Vorteile bringt uns das Sprachenlernen?
Es gibt immer mehr leistungsfähige Übersetzungsapps und -webseiten. Doch wer sich ausschließlich auf digitale Helfer verlässt, statt eine Fremdsprache selbst zu lernen, verschenkt wertvolle Chancen – für die persönliche Entwicklung und die eigene geistige Fitness.
Aber bevor uns wirklich bewusstwird, warum es sich lohnt, nach der Schule, in der Ausbildung, im Studium und im Job weiter in die eigenen Sprachkenntnisse zu investieren, vergehen manchmal viele Jahre. Verschenkte Zeit, wenn man die ausschließlich positiven Effekte des Sprachtrainings und die Vorteile vom Sprachenlernen näher betrachtet.
1. Sprachtraining ist Gehirntraining
Fit in mehr als einer Sprache zu sein, fordert unser Gehirn massiv und sorgt nach Erkenntnissen von Neurowissenschaftlern sogar dafür, dass die graue Masse wächst und sich besser vernetzt. Das ist relevant für die geistige Leistungsfähigkeit in dem Alter, in dem wir noch dabei sind, Karriere zu machen und uns im Job zu behaupten.
Es lohnt sich jedoch auch, wenn wir älter werden und die graue Masse zu schrumpfen beginnt, unsere mentale Leistungsfähigkeit aber nach wie vor gefragt ist. Denken und Sprechen in mehr als einer Sprache fordert die exekutiven Funktionen des Gehirns besonders. Sie sorgen dafür, dass wir uns konzentrieren und die Aufmerksamkeit fokussieren können.
Bei Mehrsprachigkeit gelingt es dem Gehirn noch besser, sich auf die relevanten Informationen zu konzentrieren und irrelevante Informationen auszublenden – einfach, weil es darauf ausgerichtet ist, den Überblick in dem Sprachwirrwarr zu behalten und Wichtiges gegen Unwichtiges abzugrenzen.
Das trainiert das Gehirn und lässt das Gehirnvolumen in den entsprechenden Bereichen wachsen, ähnlich wie ein Muskel wächst, wenn man ihn trainiert. So sorgt das Fremdsprachentraining auch dafür, dass sich die kognitive Leistung verbessert, die auf den exekutiven Funktionen beruht: das flexible Wechseln zwischen Aufgaben etwa, die inhibitorische Kontrolle, das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung.
2. Sprache bestimmt das Denken
Ego cogito, ergo sum, „ich denke, also bin ich“, sprach einst der französische Philosoph René Descartes. Was er noch nicht ahnen konnte ist, wie Sprache unser Denken bestimmt und damit auch unsere Kultur.
Den Beweis, dass die Muttersprache die Wahrnehmung der Welt um uns herum beeinflusst, verdanken wir Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen in den Niederlanden. Schon seit Jahrzehnten wunderten sich Forscherinnen und Forscher, dass es in manchen Kulturen keine Wörter für räumliche Beschreibungen wie „rechts“ oder „links“ gibt und sich Menschen trotzdem orientieren können. Die Vermutung lautete, dass sie sich räumliche Beziehungen auch anders vorstellen, sie anders denken.
Mit wissenschaftlichen Messmethoden wie EEG und Blickfeldmessung starteten die Forschende sprachvergleichende Untersuchungen mit englischen, deutschen und niederländischen Muttersprachlern. Für die deutschen und englischen Probanden konnten sie konkret nachweisen, dass die deutschen Muttersprachler sich eher auf das Ziel einer Handlung fixierten und darauf reagierten, während die englischen Muttersprachler eher auf den Handlungsverlauf achteten.
Wer sich ein bisschen mit der englischen Sprache beschäftigt hat, kann das nachvollziehen: während die Verlaufsform, repräsentiert durch die „ing“-Endung des Verbs, im Englischen häufig gebraucht wird, gibt es dazu in der deutschen Grammatik keine Entsprechung. Wenn also die nächste Verhandlungsrunde mit den englischen Kolleginnen und Kollegen etwas länger dauert, könnte es genau daran liegen: Ihnen ist die Verhandlung wichtiger als das Ergebnis. Was wir als kulturellen Unterschied empfinden, lässt sich mit Sprachtraining besser verstehen und womöglich sogar überwinden.
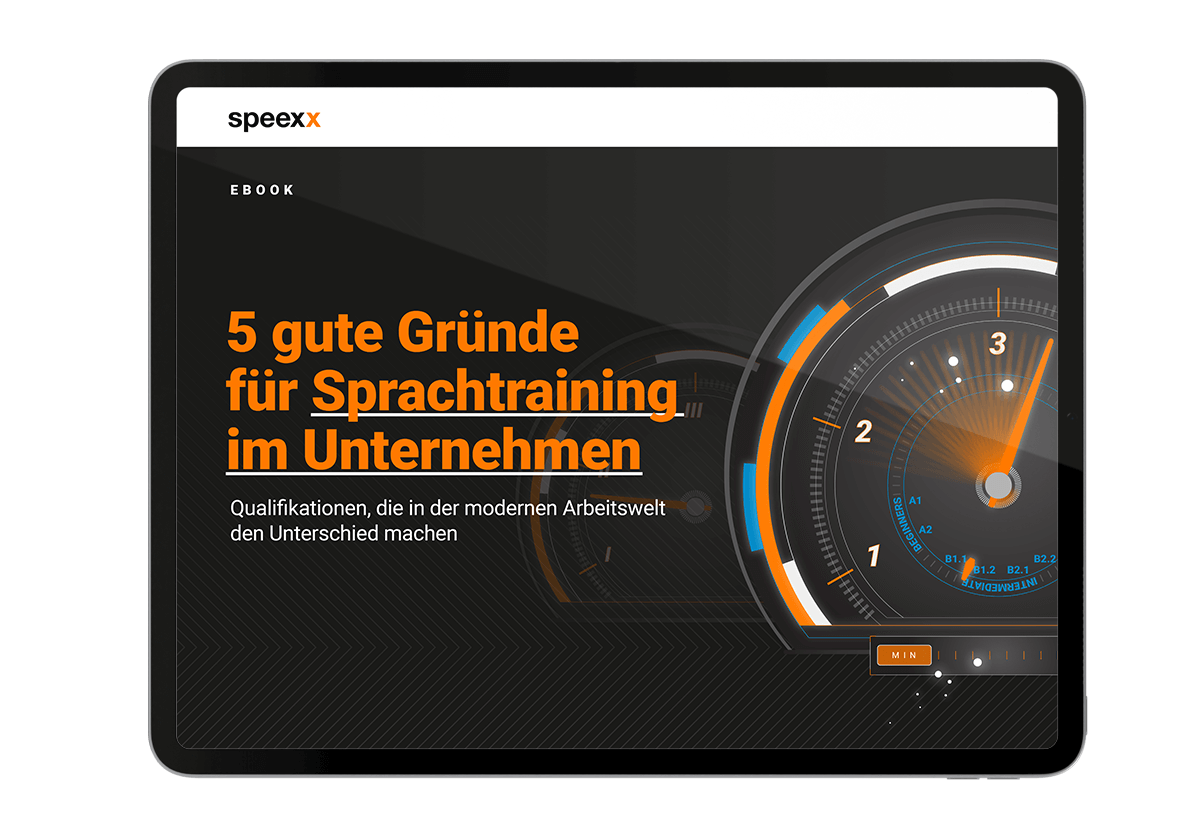
Hier finden Sie es heraus!
3. Emotionale Distanz für bessere Entscheidungen
Auch wenn es darum geht, rationalere Entscheidungen im Job zu treffen, die emotionale Distanz zu wahren und attraktive Gelegenheiten zu nutzen, helfen Fremdsprachenkenntnisse. Das haben Forschende an der Universität Chicago herausgefunden: Eine Fremdsprache bietet demnach einen distanzierenden Mechanismus, der Menschen vom unmittelbaren intuitiven System zu einem überlegteren Denkmodus bewegt, heißt es in der Studie „The Foreign Language Effect“: Thinking in a Foreign Tongue Reduces Decision Biases“.
Für die Studie arbeiteten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit englischsprachigen Studierenden, die Spanisch gelernt hatten. Das Experiment, in dem es darum ging, eine finanzielle Entscheidung zu treffen, wurde von einer Gruppe Studenten in der englischen Muttersprache, von der anderen in der Fremdsprache Spanisch durchgeführt. Das Experiment untersuchte, wie wahrscheinlich es war, dass die Studierenden attraktive Wetten abschlossen, je nachdem, in welcher Sprache sie ihre Optionen betrachteten. Wurde das Experiment in der Muttersprache Englisch durchgeführt, dachten die Studierenden emotional und entschieden kurzsichtig. Im spanisch-sprachigen Experiment dagegen trafen sie eine rationale Entscheidung.
Als vielleicht wichtigsten Mechanismus für diesen Effekt definierten die Forschenden, dass eine Fremdsprache weniger emotionale Resonanz auslöst als die Muttersprache. Was den Vorteil hat, dass Entscheidungen weniger durch Angst motiviert sind und Chancen eher genutzt werden. Die neuen Erkenntnisse seien relevant dafür, wie Menschen in einer globalen Gesellschaft Entscheidungen treffen, da immer mehr Menschen täglich eine Fremdsprache verwenden würden, heißt es in dem Forschungsbericht. Das Denken in einer Fremdsprache könnte sehr vorteilhaft sein, wenn es darum geht, Entscheidungen in einem geschäftlichen Umfeld oder bei persönlichen Finanzen zu treffen.
4. Fremdsprachen als Erfolgsfaktor in der globalen Wirtschaft
Das Fremdsprachen ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Wirtschaft sind, stellt auch das Institut der deutschen Wirtschaft in seinem IW-Zukunftspanel fest. Die grundlegende Basis für Globalisierung und Wissensintensivierung ist Kommunikation, die über die eigenen Grenzen hinaus reibungslos funktionieren muss, um erfolgreich zu sein. Kenntnisse fremder Sprachen und Kulturen sind dafür unerlässlich.
Das beispielsweise beim Schreiben von E-Mails im Business-Kontext Übersetzungs-Apps eine erste Hilfe sein können, bestreiten wir nicht. Das Sprachenlernen indes machen sie nicht überflüssig. Denn selbst Apps, die der Beschreibung nach mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, sind nur für die Übersetzung von Sachtexten wirklich geeignet. Emotionen verstehen sie zum Beispiel nicht, was leicht zu unangenehmen Missverständnissen führen kann.
Um Übersetzungen überprüfen zu können, brauchen Mitarbeitende Sprachkenntnisse. In der mündlichen Business-Kommunikation sind Übersetzungs-Apps kurz gesagt ein Störfaktor, wie sich jeder leicht vorstellen kann. Erst in die App sprechen oder tippen, dann die Übersetzung anhören oder vorlesen, bevor der Gesprächspartner genauso antwortet – da dauern Gespräche leicht drei Mal so lang. Ganz abgesehen, dass diese Vorgehensweise sicher nicht für Professionalität spricht.
Warum sind Sprachkenntnisse so wichtig für die Karriere?
Wer Karriere machen will, braucht heute nicht mehr nur Fachkenntnisse. In den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind die so genannten Soft Skills wie allgemeine Kommunikationskompetenz, Networking, Verständnis für verschiedene Kulturen oder Präsentationskompetenz. Dazu kommen grundlegende Fähigkeiten wie digitale Kompetenzen. Vor dem Hintergrund der globalisierten Wirtschaft ist auch die Bereitschaft zu einer internationalen Karriere erwünscht und die Teilnahme an entsprechenden Weiterbildungsangeboten wie Firmensprachkursen wird in Unternehmen gerne gesehen. Sehen wir uns im Einzelnen an, welche Vorteile Fremdsprachenkenntnisse für Mitarbeitende und Unternehmen bieten:
1. Kommunikation auf allen Wegen
Kommunikation besteht immer aus mehr als Sprache und Wörtern. Wichtig sind auch Mimik, Gestik und Betonung. Fällt auch nur ein Teil weg, etwa weil man sich zum Beispiel am Telefon nicht sehen kann und nur schwer zu verstehen ist, müssen die Sprachkenntnisse umso besser sein, um ohne Missverständnisse kommunizieren zu können. Ebenfalls wichtig zu wissen: Wie antworte ich auf eine Frage, die in einer fremden Kultur womöglich anders beantwortet werden sollte als in der eigenen.
2. Internationale Karriere als Führungskraft
Noch bessere Kenntnisse der Fremdsprache sollten vorhanden sein, wenn ich als Führungskraft kommunizieren will. Schließlich ist der Erfolg auch davon abhängig, wie gut der Austausch mit dem Team funktioniert. Mangelnde Sprachkenntnisse dagegen können die Akzeptanz und damit auch das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit empfindlich beeinträchtigen und der Karriere schaden.
In jedem Fall gilt: Wer nicht nur geschäftliche Themen perfekt formuliert mit einem Gesprächspartner besprechen kann, sondern auch den Smalltalk beherrscht und weiß, wie viel Smalltalk zu welchen Themen in der anderen Kultur gefragt ist, hat einen Vorteil und kommt schneller voran, im Projekt wie in der Karriere.
3. Mit Networking zum nächsten Job
Mit den internationalen Business-Netzwerken im Internet kam eine ganz neue Möglichkeit auf, eine internationale oder nationale Karriere zu starten. Wenn man denn weiß, worauf und wie man am besten auf eine Äußerung reagiert und mit kurzen, aber aussagekräftigen und meinungsstarken Posts auf sich aufmerksam macht. Dabei kann man leicht die Erfahrung machen, dass es schwieriger ist, in wenigen Worten eine Aussage zu machen, als in einem langen Text.
Ein besonderer Tipp: Viele Mitglieder der Business-Netzwerke gehören dem englischen Sprachraum an. Dabei handelt es sich allerdings nicht um „den“ einen Sprachraum. Das sich britisches und amerikanisches Englisch durchaus unterscheiden, ist in den kurzen Posts besonders gut zu sehen.
4. Präsentation ist nicht gleich Präsentation
Der Erfolg einer Präsentation ist in der Regel von drei Dingen abhängig: Wie gut die entsprechenden Folien visuell und mit Text aufbereitet sind, ob das Thema spannend und unterhaltsam aufgebaut ist und natürlich, wie sie präsentiert wird. Das ist oft mit mehr Tücken verbunden, als es sich auf den ersten Blick anhört und das gilt selbst für so simpel erscheinende Übersetzungen wie aus dem Englischen ins Deutsche und umgekehrt.
Der Grund: Hier ist kein langer Text gefragt, sondern kurze und genaue Ausdrücke, die wohl formuliert sein wollen und tiefgründige Sprachkenntnisse erfordern, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Auch die Art der Präsentation unterscheidet sich von Kultur zu Kultur. Daten und Fakten sind nicht überall entscheidend für den Erfolg. Es kommt auch darauf an, das Publikum mitzunehmen und mit seinem Thema zu erreichen.

5. Interkulturelles Training inklusive
Sprache ist keine künstlich geschaffene Struktur, sondern ein lebendiges, verbales und schriftliches Kommunikationswerkzeug, dass sich ständig verändert. Wie wir sprechen und uns ausdrücken, ist unmittelbar mit unserer Kultur verbunden – und unterscheidet sich, obwohl die Welt gefühlt immer näher zusammenrückt. Es hilft enorm, sich in die fremde Kultur hineinzuversetzen und zu verstehen, wie sie die Welt wahrnehmen. Der internationalen Karriere steht damit nichts mehr im Weg.
Sprachtraining lohnt sich
Fremdsprachenkenntnisse helfen Ihnen nicht nur, sich besser in einer Sprache zu verständigen, sie sind auch vorteilhaft für das Knüpfen sozialer Kontakte, das Verstehen fremder Kulturen, für die Entscheidungsfindung und für die geistige Leistungsfähigkeit. Ob im Alltag oder im Beruf – es gibt jede Menge gute Gründe, eine neue Sprache zu lernen oder vorhandene Sprachkenntnisse zu erweitern.
